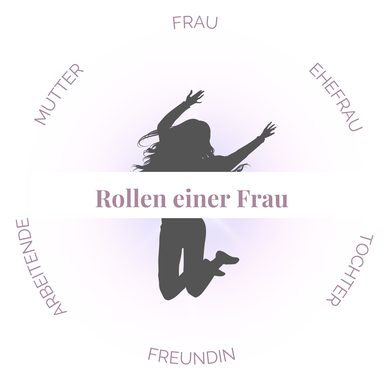
Gesellschaftliche Erwartungen an Frauen
Manchmal bin ich ganz schön verblüfft, welche Vorstellungen und Erwartungen die Gesellschaft an Frauen stellt. Wir sollen hübsch sein, sportlich, möglichst nicht alt werden oder zumindest nicht so aussehen. Während Männer mit dem Alter oft als „charismatisch“ gelten, heißt es bei Frauen: „Sie ist aber alt geworden.“
Doch nicht nur die Erwartungen an unser Äußeres sind verrückt. Auch in Bezug auf unsere Leistung. Wir sollen aufopferungsvolle Mütter von perfekt erzogenen Kindern sein, aber natürlich auch arbeiten gehen – am besten Vollzeit. Gleichzeitig sollte auch unser Haushalt sauber und gepflegt sein, der Rasen im Vorgarten die 10-cm-Marke nicht überschreiten.
Das liest sich wie die Anleitung einer Fantasiefigur, aber nicht wie das Leben einer Frau, die ebenso nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung hat.
Oft heißt es, das Patriarchat sei schuld, Frauen seien vor allem Opfer. Ich persönlich möchte mich aber nicht in eine Opferrolle hineinstellen lassen.
Natürlich gibt es gesellschaftliche Strukturen, die Frauen benachteiligen. Aber für mich persönlich ist es keine Hilfe, nur dem System oder den Männern die Schuld zu geben. Damit würde ich ja meine eigene Handlungsfreiheit abgeben und mich von anderen abhängig machen. Ich möchte Verantwortung für mein Leben übernehmen, auch dann, wenn es schwierig ist und ich manche meiner Entscheidungen später kritisch sehe. Für mich ist das ein Weg, nicht in der Opferrolle stecken zu bleiben.
Gleichzeitig weiß ich: Es gibt Frauen, die tatsächlich Opfer sind. Frauen, die unterdrückt werden, festgehalten sind, die Gewalt erleben oder denen gegen ihren Willen Schlimmes angetan wird. Für sie dürfen wir nicht die Augen verschließen. Wir sind als Christinnen aufgerufen, für sie zu beten und ihnen beizustehen, wo uns das möglich ist.
Und letztlich glaube ich: Es sind nicht „die Männer“ oder „das System“, die das eigentliche Problem darstellen. Es ist die Sünde, die in dieser gefallenen Welt herrscht und die Sünde, die in jedem von uns steckt. Darum sehnen wir uns nach Erlösung. Nur bei Jesus finden wir Freiheit, Heilung und den wahren Maßstab für unser Leben.
Doch die Frage bleibt: Warum ist es manchmal so schwierig, Frau zu sein? Und was macht mich eigentlich zur Frau?
Was macht mich zur Frau?
Biologie und Identität
Biologisch gesehen machen mich die XX-Chromosomen, die äußeren und inneren Geschlechtsorgane und die Östrogendominanz zur Frau. Dazu kommt die Fähigkeit, Kinder zu bekommen, auch wenn nicht jede Frau Kinder haben kann oder will.
Das ist die biologische Seite. Aber sie greift zu kurz.
Denn Frau sein ist mehr als Biologie. Es zeigt sich auch in meinem Erleben, meiner Identität und meinem Sein:
- in meiner Art, Beziehungen zu gestalten,
- in meiner Sensibilität für Stimmungen,
- in meiner Freude daran, Schönheit zu erschaffen, sei es mit Worten, im zuhause oder im Miteinander,
- und in einer Stärke, die oft im Aushalten, Tragen und Hoffen sichtbar wird.
Empathie und Fürsorge – angeboren oder anerzogen?
Wir Frauen sind im Durchschnitt empathischer, sorgen uns stärker um unser Umfeld und pflegen Beziehungen. Ist das wirklich nur anerzogen? Ich glaube nicht.
Studien zeigen, dass Eigenschaften wie Empathie, Fürsorge und Beziehungsorientierung auch biologische Grundlagen haben:
- Eine groß angelegte Untersuchung mit über 305.000 Teilnehmenden in 57 Ländern hat bestätigt, dass Frauen im Durchschnitt besser darin sind, Gedanken und Gefühle anderer allein aus den Augen zu erkennen (Theory of Mind) und das kulturübergreifend (University of Cambridge, 2018).
- Neurowissenschaftliche Studien zeigen Unterschiede im Gehirn: Frauen haben im Schnitt größere Volumina in Arealen wie dem anterioren cingulären Cortex oder dem limbischen System. Regionen, die eng mit Empathie und emotionaler Verarbeitung verbunden sind (TU Braunschweig).
- Auch Hormone spielen eine Rolle: Höhere Oxytocinspiegel bei Frauen fördern Bindung und Fürsorge. Dagegen führt pränatales Testosteron zu geringerer Ausprägung empathischer Fähigkeiten (Allure, Wikipedia mit Quellen).
- Eine aktuelle Studie von 2023 zeigt: Frauen reagieren auf emotionale Szenen mit deutlich mehr Mitgefühl und sind eher bereit, prosozial zu handeln (z. B. Spenden). Unterschiede im reinen Erkennen (kognitive Empathie) waren kleiner, aber im Mitfühlen zeigten Frauen mehr Intensität (Nature Scientific Reports, 2023).
Natürlich heißt das nicht, dass jede Frau empathischer ist als jeder Mann. Aber insgesamt zeigen die Ergebnisse: Empathie und Fürsorge sind uns nicht nur anerzogen – sie sind uns auch in die Wiege gelegt.
Was ich am Frau sein liebe
Und um ehrlich zu sein: Ich liebe es, Frau zu sein.
Ich mag es, emotional schnell berührt zu sein, wenn mich ein Lied mitten ins Herz trifft oder die Tränen kommen, weil mich etwas bewegt. Ich mag es, mitzufühlen und mich um meine Familie zu kümmern. Ich habe gerne die Geburtstage im Blick und überlege mir passende Geschenke, die Freude machen. Ich genieße es, das Wohl meiner Familie im Herzen zu tragen, wie einen inneren Kompass.
Auch wenn ich bei weitem keine „Vorzeigefigur“ habe, ich mag meinen Körper, mit all seinen Spuren, Rundungen und Eigenheiten. Wenn ich mich im Spiegel sehe, erinnere ich mich daran: Mein Körper erzählt eine Geschichte – meine Geschichte. Eine Geschichte voll Liebe, Hingabe, Tränen, Lachen, von durchlebten Kämpfen und gelebtem Leben.
Ich mag es, mich leicht zu schminken und mich hübsch zu machen. Nicht aus Zwang, sondern weil es mir Freude macht, das Schöne an mir zu betonen. Ich mag kein Mann sein und auch nicht wie einer behandelt werden. Im Gegenteil: Ich genieße es, Frau zu sein. Ich bin froh in Zeiten des Kriegs nicht einrücken zu müssen. Und ja, ich kann auch handwerkliche Arbeiten durchführen, aber mir ist es lieber, wenn wer anderes (Mann) das macht.
Ich liebe es, tiefgründige Gespräche mit anderen Frauen zu führen – über das Leben, den Glauben, über Hoffnungen und Ängste. Diese Verbundenheit ist für mich ein Stück Heimat.
Natürlich hat jede Frau ihre ganz eigenen Vorlieben und Gaben. Aber für mich gehören diese kleinen Dinge zum Frau sein dazu. Sie machen es reich, schön und manchmal auch herausfordernd. Und sie erinnern mich daran: Frau sein ist ein Geschenk Gottes, keine Last.
Frau sein und älter werden
Ein Thema, das uns Frauen besonders betrifft, ist das Älterwerden. Gesellschaftlich scheint das Altern bei uns fast ein Makel zu sein, etwas, das es um jeden Preis zu kaschieren gilt.
Doch warum eigentlich? Meine Falten erzählen Geschichten: von Lachen, von Sorgen, von durchwachten Nächten mit Babys, von intensiven Gesprächen. Mein Körper ist nicht mehr derselbe wie mit zwanzig, aber deshalb ist er nicht weniger wert.
Oft habe ich Tage, an denen ich es liebe, älter zu werden. Dinge, die mich früher genervt haben, sind mir inzwischen egal. Ich werde immer selbstsicherer und lasse mich nicht mehr so schnell von jedem Windhauch umpusten. Was andere über mich denken oder von mir halten, ist mir auch immer egaler. Denn ich weiß mittlerweile, wie selten sich die anderen Gedanken über mich machen.
Instagram & Co zeigen uns glattgebügelte Gesichter, durch verschiedenste Filter. Aber es ist herrlich befreiend, an einem Badesee zu sitzen und zu sehen: Keine einzige Frau entspricht diesem „Instagramface“. Und umgekehrt: Diese künstlichen Gesichter kommen keiner echten Frau nahe.
In Gottes Blick ist das Alter kein Makel, sondern ein Reichtum. In Sprüche 16,31 heißt es: „Graue Haare sind eine Krone der Ehre; sie wird auf dem Weg der Gerechtigkeit gefunden.“ Und auch wenn unsere Gesellschaft Jugend verherrlicht, sieht Gott Weisheit, Erfahrung und Würde.
Frau sein bedeutet deshalb für mich auch: mein Alter annehmen zu dürfen, ohne mich dafür zu schämen.
Gesellschaftlicher Auftrag und die Frage der Abhängigkeit
Gesellschaftlich hat sich in den letzten Jahrzehnten vieles verändert. Frauen haben heute die gleichen Rechte wie Männer. Sie sind gleichberechtigt, aber nicht gleichartig. Gleichwürdig, aber nicht gleich. Und doch erleben wir: Trotz all der erkämpften Freiheiten bleibt der Druck groß.
Früher galt der gesellschaftliche Auftrag klar: Mutter und Hausfrau sein. Heute lautet er: Sei Mutter, Hausfrau, berufstätig, leistungsfähig, und verwirkliche dich bitte auch noch selbst. Was nach mehr Freiheit klingt, führt in der Realität oft dazu, dass Frauen immer mehr leiden. Denn anstatt, dass es leichter geworden ist, haben sich die Erwartungen vervielfacht.
Viele Frauen möchten arbeiten gehen, sich selbst verwirklichen. Manche wollen keine Kinder, und auch das ist okay. Aber darf eine Frau sich heute noch entscheiden, „nur“ Mutter und Hausfrau zu sein? Gilt sie dann immer noch als stark, unabhängig, wertvoll?
Gesellschaftlich heißt es schnell: „Nein, sie ist abhängig von ihrem Mann.“ Und ja, das stimmt in gewisser Weise. Aber: Sind wir nicht alle abhängig? Wir Frauen, die wir arbeiten gehen, sind abhängig von Arbeitgebern, von Kunden, von der Wirtschaftslage. Unabhängigkeit ist immer nur relativ. Selbst wenn wir Vollzeit arbeiten gehen, damit wir am Ende eine gute Pension haben … wer sagt uns, dass das so bleibt?
Baue nicht auf Sand! (vgl. Matthäus 7,24–27)
Die eigentliche Frage lautet nicht: Abhängig oder unabhängig?
Sondern: Von wem sind wir abhängig?
Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir: Gott hat Männern einen Auftrag gegeben, ihre Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt (Epheser 5,25). Ein Arbeitgeber hat diesen Auftrag nicht. Ein Kunde auch nicht. Aber ein Mann, der nach Gottes Willen lebt, soll seine Frau schützen, ehren, lieben und für sie sorgen – bis hin zur Selbsthingabe. So wie Jesus seine Gemeinde liebt.
Lasst uns mal nachdenken, wie sehr Jesus seine Gemeinde liebt und was er am Kreuz für uns getan hat. Abhängigkeit von einem solchen Maß an Liebe ist keine Schwäche. Sondern ein Teil von Gottes gutem Plan.
Und auch wir Frauen haben einen klaren Auftrag im Neuen Testament:
Jüngerin sein: Jesus nachfolgen, zuhören, glauben, Zeugnis geben.
📖 (Lukas 8,1–3)
Zeugin des Evangeliums sein: wie Maria Magdalena und die anderen Frauen, die als Erste die Auferstehung bezeugten.
📖 (Johannes 20,18)
Gaben einsetzen in Gemeinde und Familie: durch Lehren, Dienen, Beten, Gastfreundschaft und die Weitergabe des Glaubens an Kinder und andere Menschen.
📖 Apostelgeschichte 18,26)
📖 (2. Timotheus 1,5)
Heilig leben: mit einem Lebensstil, der auf Christus hinweist und Hoffnung weiterträgt.
📖 (1. Petrus 3,3–4)
📖 (1. Petrus 3,15)
Das sind keine zusätzlichen Erwartungen, die uns noch mehr Lasten auflegen. Sondern es ist Gottes gute Einladung, in seiner Kraft zu leben – frei von dem Druck, es allen recht machen zu müssen.
Blick zurück: Abraham und Sarah
Gesellschaftliche Erwartungen gab es schon immer, und sie hatten oft schwerwiegende Folgen. Zur Zeit Abrahams und Sarahs war es die wichtigste Aufgabe einer Frau, Kinder zu bekommen. Wer unfruchtbar war, galt als unvollständig. Dieser Druck war so groß, dass Sarah irgendwann beschloss, „nachzuhelfen“: Sie gab ihre Magd Hagar Abraham zur Frau, damit wenigstens durch sie Nachkommen gezeugt werden (1. Mose 16).
Doch was geschah? Statt Freude brachte diese Entscheidung Streit, Eifersucht, Schmerz und Zerbruch in die Familie. Ein klassisches Beispiel dafür, wie menschliche Versuche, gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden, Unheil bringen können.
Gottes Plan war ein anderer. Er wollte Sarah selbst segnen und ihr, trotz ihres hohen Alters, einen Sohn schenken. Nicht, weil sie sich dem gesellschaftlichen Druck beugte, sondern weil er ihr in seiner Gnade etwas geben wollte, das menschlich unmöglich schien (1. Mose 21).
Frau sein im Blick Gottes
Wenn wir beginnen, unser Frau sein im Blick Gottes zu leben, verändern sich die Maßstäbe. Dann müssen wir nicht mehr jedem gesellschaftlichen Ideal entsprechen. Sein guter Plan gibt uns Sicherheit. Er sagt: Du bist wertvoll, weil ich dich geschaffen habe, nicht weil du einer Rolle gerecht wirst.
Für verheiratete Frauen gibt es von Gott einen klaren Auftrag. In Epheser 5,22–25 beschreibt Paulus das Miteinander von Mann und Frau: „Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie hingegeben.“
Das ist kein Freibrief für Unterdrückung, sondern eine Einladung zu gegenseitiger Hingabe und Liebe, die von Christus selbst geprägt ist.
Und auch für Frauen, die nicht verheiratet sind, gibt es eine besondere Perspektive. Paulus schreibt in 1. Korinther 7,34: „Eine unverheiratete Frau sorgt sich uneingeschränkt darum, mit Leib und Seele für den Herrn da zu sein. Aber eine verheiratete Frau sorgt sich um menschliche Belange und will ihrem Mann gefallen.“
Das heißt nicht, dass Ehe ein Nachteil ist, sondern dass Alleinstehende die Chance haben, ihre ganze Kraft und Liebe Gott zu widmen.
Ob verheiratet oder alleinstehend, Mutter oder kinderlos: Frau sein im Blick Gottes bedeutet, frei zu werden von gesellschaftlichem Druck und Geborgenheit in seiner Berufung zu finden.
Schlussgedanke
Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel: Immer dann, wenn wir Menschen unsere eigenen Regeln machen und versuchen, unabhängig von Gott zu sein, geraten wir in Schwierigkeiten. Wir übernehmen Erwartungen der Gesellschaft, beugen uns dem Druck oder basteln uns Lösungen, die am Ende mehr Last als Freude bringen.
Doch wenn wir Frauen uns auf Gottes Plan einlassen, finden wir Freiheit. Dann müssen wir nicht mehr beweisen, wie stark, unabhängig oder perfekt wir sind. Wir dürfen einfach leben als die Frauen, die er geschaffen hat: geliebt, gewollt, begabt.
Also: Lass dir gesellschaftlich nichts überstülpen. Leg die Ketten ab, die Jesus längst gesprengt hat, und richte deinen Blick auf den Vater. Dort liegt wahre Freiheit.
Mehr zum Thema "Alleinerziehende Mütter"?
In meiner Broschüre "Alleinerziehende in der Gemeinde: verstehen - begleiten - mittragen" findest du praktische Impulse für Gemeinden.
Gemeinschaft tut gut!
Wenn du auf der Suche nach Infos, Tipps und Ideen bist oder dich austauschen möchtest, dann schau gerne bei unserem Padlet & Mini-Forum vorbei.

Kommentar schreiben